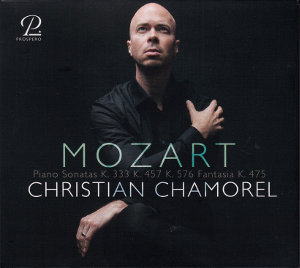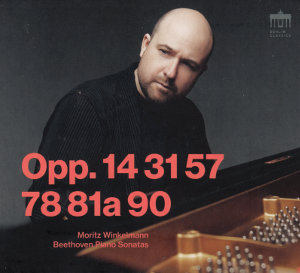Mariam Batsashvili
Influences
Haydn | Mozart | Beethoven | Liszt

Warner Classics 5021732535177
1 CD • 68min • 2024
11.07.2025
Künstlerische Qualität:![]()
Klangqualität:![]()
Gesamteindruck:![]()
Die hochromantische Klaviermusik von Chopin und Liszt hat für die 1993 in Georgien geborene und in Tiflis und Weimar ausgebildete Pianistin Mariam Batsashvili eine besondere Bedeutung: Sie hat die Franz-Liszt-Wettbewerbe in Weimar und in Utrecht gewonnen und ihre Debut-CD galt ebenfalls diesen beiden Komponisten. Ihr Album mit dem Titel „Influences“ möchte nun demonstrieren, dass sie nicht nur Liszt „kann“, sondern auch Haydn, Mozart und Beethoven. Sie möchte hier, wie sie im zweisprachigen Booklet zitiert wird, „zeigen, wie diese vier Komponisten die Sonatenform als Ausdrucksmittel genutzt haben“, und sie hat diese Sonaten chronologisch angeordnet, „damit die Hörer die Entwicklung erleben können.“
Überzeugender Ausdruckswille
Mariam Batsashvili demonstriert hier durchaus überzeugend Ausdruckswillen sowie individuelle Gestaltungskraft für jeden einzelnen Satz. Espritvoller Spielwitz und treibende Energie beherrschen den Kopfsatz der D-Dur-Sonate Nr. 37 von Haydn: Das Klavier meint man bei diesem Spiel geradezu lächeln zu sehen. Deutlich abgesetzt mit seinem Tiefsinn und seiner Schwermut ist der langsame Zwischensatz mit klangvollen, ja klangrauschenden Arpeggien wie Harfenklänge und mit ewig nachhallenden Schlussakkorden. Dem Dualismus von Dur und Moll und dem Wechsel der atmosphärischen Zwischensätze im Rondo spürt die Pianistin mit ernsthafter Entschlossenheit nach.
Die Hornrufe im Hauptthema der D-Dur-Sonate KV 576 von Mozart könnte Mariam Batsashvili noch markanter und die Triller noch graziöser formulieren, um darzulegen, wie Mozart schon das Thema dialogisch aufbaut: In Mozart liegt doch noch mehr Tiefsinn, als man glaubt. Dafür ist die Mollvariante des Thema schön verhangen: Batsashvili sucht scheinbar überall die Klangschönheit und den Farbenreichtum. Auch wenn sie den fis-Moll-Teil des Adagios nachdenklich spielt, ist (mir) dieser Satz insgesamt zu rasch – als ob sie der Ruhe, die in dieser Musik liegt, nicht ganz traut. Alfred Brendel zum Beispiel braucht hierfür 5:20 Minuten, wo Batsashvili 4:56 Minuten genügen. Brendel hat hier eine bezwingendere Ruhe und dadurch einen logischeren Zug, mehr drängendes Legato, mehr verhangene Wehmut und auch mehr emotionale Kraft in den Läufen und mehr Leuchtkraft auch im Piano. Dafür sprudelt bei Batsashvili das Finale übermütig und überraschungsreich dahin.
Selbstbewusster Zugriff und orchestrale Klangfülle
Liszts Après une lecture de Dante hat Mariam Batsashvili schon mit 13 Jahren gespielt – nachdem ihre Lehrerin sie gezwungen hatte, Dantes ganze „Divina Commedia“ zu lesen: eine zweifache Gewaltleistung für ein junges Mädchen. Jetzt überwältigen ihre souveräne Technik, ihr selbstbewusster Zugriff und ihre orchestrale Klangfülle sowie ihre Dispositionspotenz, die alle ihr Thema der „Influences“ in allen Klangfarben strahlend darlegen. Sie schafft dabei eine spannungsvolle, ja angstzitternde Atmosphäre, heroischen Überschwang und glockenklingende Hymnik in dieser „Fantasia quasi Sonata“. Was vielleicht andere Pianisten wie z. B. Lazar Bermann (1971) ihr an stürmisch-stählerner Gewalt voraushaben, macht sie durch ihren eminenten Klang- und Farbenreichtum wieder wett.
Stupende Virtuosität
Joachim Kaiser hat für Beethovens Appassionata in seinem Buch „Beethovens 32 Klaviersonaten und ihre Interpreten“ vier Herangehensweisen herusgearbeitet: Geballte Gemessenheit, Zurückhaltung und Raserei, Horror-Roman konsequenten Zerstörens und wohllautende Harmonisierung. Mariam Batsashvili scheint mir hier eine Mischung aus wohllautender Harmonisierung und geballter Gemessenheit gewählt zu haben. Sie will wohl dem Schrecken noch Schönheit abgewinnen. Die Basstöne lässt sie wunderbar sonor erklingen – darin unterstützt von der sehr guten Aufnahmetechnik –, lässt aber auch das lauernde Grauen darin erzittern. Vor allem im wilden Ritt des Finales sucht sie – und das mit großem Erfolg! – in der auskomponierten Gestaltlosigkeit noch Klarheit, Schönheit und Beherrschtheit. Darin hilft ihr ihre stupende Virtuosität. Auch wenn die Coda dann doch mit furioser Gewalt wild hervorbricht – sie scheint sich mit ihren 7:54 Minuten für diesen Finalsatz eher an der kontrollierten Raserei von Alfred Brendel (1962) zu orientieren als mit der maßlos-wilden Erregtheit etwa von Friedrich Gulda mit 7:15 Minuten oder Michael Korstick (2003) mit 7:22 Minuten. So hört man in den rasenden Läufen jeden einzelnen bewusst gestalteten Ton und kein gestaltloses bloßes Dahinrasen: eine glänzende Demonstration von kontrolliertem Spiel.
Rainer W. Janka [11.07.2025]
Anzeige
Komponisten und Werke der Einspielung
| Tr. | Komponist/Werk | hh:mm:ss |
|---|---|---|
| CD/SACD 1 | ||
| Joseph Haydn | ||
| 1 | Klaviersonate D-Dur Hob. XVI:37 | 00:11:40 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | ||
| 4 | Klaviersonate Nr. 18 D-Dur KV 576 (Die Jagd) | 00:14:47 |
| Ludwig van Beethoven | ||
| 7 | Klaviersonate Nr. 23 f-Moll op. 57 (Appassionata) | 00:24:55 |
| Franz Liszt | ||
| 10 | Après une lecture de Dante S 161:7 (Fantasia quasi Sonata, aus: Années de pèlerinage duexième année – Italie) | 00:16:24 |
Interpreten der Einspielung
- Mariam Batsashvili (Klavier)